Badische Zeitung, Sigrun Rehm, 23. Juni 2025: Freiburger Tagung zu Frantz Fanon: Das Unbehagen mit dem Rassismus
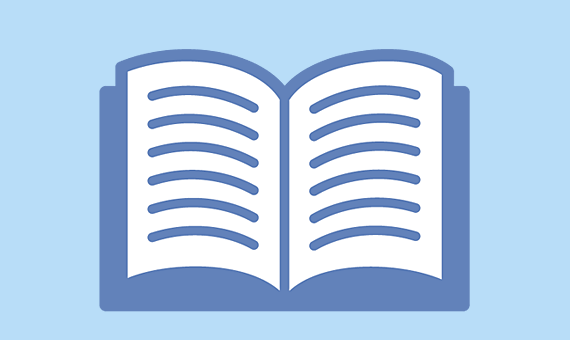
Badische Zeitung, Sigrun Rehm, 23. Juni 2025:
Freiburger Tagung zu Frantz Fanon: Das Unbehagen mit dem Rassismus
Wer Rassismus verstehen will und was er mit der Psyche der Menschen macht, kommt an Frantz Fanon nicht vorbei. Zum 100. Geburtstag des Psychiaters und Autors fand jetzt in Freiburg eine Tagung statt.
Es ist ein erstaunlicher Befund: In Psychologie, Psychotherapie und Psychoanalyse spielte der Rassismus lange Zeit keine Rolle. Noch heute ist die von Patientinnen und Patienten erlebte Ablehnung aufgrund äußerer Merkmale oft ein blinder Fleck. Auch die eigenen Vorurteile sind vielen Therapeutinnen und Therapeuten kaum bewusst. Dies zu ändern, ist seit rund 40 Jahren ein Anliegen des von Gehad Mazarweh und Angelika Rees gegründeten Psychoanalytischen Arbeitskreises für Psychotherapeuten und Psychiater von Migranten in Freiburg (Pamf). Dessen Mitglieder wissen um die Gefahr, wenn zum Trauma der Flucht die Scham über die Zurückweisung kommt und sich in Depression oder Wut wandelt. Diese kann sich dann gegen sich selbst oder gegen andere richten. Ihre Tagung "100 Jahre Frantz Fanon – Geschichte und Aktualität von Kolonialismus, Rassismus und Traumatisierung" beleuchtete am Wochenende Facetten dieses Themas.
Das Publikum im Hörsaal der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, wo die Tagung stattfindet, ist vielsprachig und divers, es sind Fachleute und Interessierte unterschiedlicher Hautfarben, die Altersspanne reicht von Anfang 20 bis über 80. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Anwesenden mit Frantz Fanons Werk vertraut sind, ihr Interesse gilt der Frage, ob und wie seine Impulse in der Psychotherapie heute wirksam sein können.
Frantz Fanon wurde 1925 auf der Karibikinsel Martinique geboren, damals eine französische Kolonie, in der die Spuren der Sklaverei überall spürbar waren. 1944 meldete er sich freiwillig, um mit den freien französischen Streitkräften gegen Nazi-Deutschland zu kämpfen und erlebte dort den Rassismus seiner weißen Kameraden. Nach dem Krieg studierte er Medizin und Philosophie, ging nach Algerien und leitete dort von 1953 an eine psychiatrische Klinik. Er arbeitete mit Gefolterten und Folterern und erkannte, wie sehr der Rassismus nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter quält und in ihrer Menschlichkeit beschädigt. 1956 schloss er sich der Nationalen Befreiungsfront für die Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich an. 1961 starb Fanon mit nur 36 Jahren an Leukämie.
Fanons Hauptwerke gehören zum Kanon postkolonialen Denkens, seine Hauptwerke "Schwarze Haut, weiße Masken" (1952) und "Die Verdammten dieser Erde" (1961) sorgten dafür, dass er bald zur Galionsfigur linker Befreiungsbewegungen in aller Welt avancierte. Die beiden Werke gehören bis heute zum Kanon postkolonialen Denkens. Dass dabei etwa der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 als "notwendige revolutionäre Gewalt" im Sinne Fanons gerechtfertigt wird, halten seine Biografen Alice Cherki und Adam Shatz für ein großes Missverständnis: Fanon habe Gewalt nie gefeiert, sein Ziel sei stets die Befreiung aller Menschen von Ausbeutung, Rassismus und Unterdrückung gewesen.
Wie er ausgehend von Fanons Beobachtungen seine Theorie des "Inneren Rassismus" entwickelte, schildert M. Fakhry Davids in seinem Eröffnungsvortrag. Der Londoner Psychoanalytiker wuchs unter dem Apartheid-Regime in Südafrika auf und erlebte selbst "die Qual, in einer weißen Gesellschaft schwarz zu sein". In Freiburg erklärt er, wie der äußere Rassismus sich in der Psyche der Betroffenen festsetzt und sich gleichsam "in die Haut einschreibt". Die literarische Übersetzerin Beate Thill widmet sich dem von Édouard Glissant, einem Philosophen und Weggefährten Fanons, postulierten "Rechts auf Opazität" – was bedeutet, dass niemand sich vollständig durchschauen lassen muss. Am Ende zeigt die Psychotherapeutin Heejung Jordan an einem Fallbeispiel eindrucksvoll, wie sie gerade im Spannungsfeld von Annäherung und Nichtwissen einem schwer traumatisierten jungen Afghanen helfen konnte.
So können Frantz Fanons Impulse die Psychotherapie tatsächlich um eine wichtige Dimension erweitern. Wie aktuell und persönlich seine Erkenntnisse wirken, zeigt sich in den Diskussionen, wenn als stereotyp empfundene Bilder oder Begriffe bei Teilnehmenden heftiges Unbehagen und Widerspruch auslösen.
Aber – und das ist anders als vor 100 Jahren – all das darf gesagt werden und wird angehört.